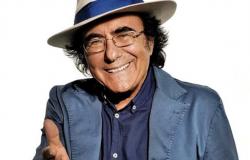„Metamorphe Instabilität“ (S.47) und dann auch „tückische Vergänglichkeit der Formen“ (S.101). Dies scheinen die charakteristischen Elemente in der Geschichte von Michele Maris neuem Roman zu sein, die von einem anonymen Erzähler in der Ich-Perspektive erzählt wird. Locus desperatus, Einaudi 2024. Es ist ein neurotisches Ego einer absoluten Neurose, das ständig ein Gefangener der verschiedenen Schutzrituale ist, von denen sich seine Neurose ernährt, um sich selbst einzuschränken. Doch damit nicht genug, auch weil er eines traurigen Morgens das Kreuzzeichen an seiner Haustür entdeckt, gezeichnet von einer ebenso anonymen Hand. Orientierungslosigkeit und Destabilisierung befallen ihn. Wer hat sein Tor geschossen? Was bedeutet dieses Zeichen, oder besser gesagt DAS Zeichen? Geht es um eine rettende Wahl oder eine Zerstörung?
Er findet bald heraus, was los ist, zumindest denkt er.
Eine bestimmte Gruppe mysteriöser Charaktere möchte einfach, dass er sein Haus, ein Hausmuseum voller Dinge und Bücher, verlässt, um ihn zu ersetzen und seine Nachfolge anzutreten.
Aber selbst die Anhänger dieser rätselhaften Sekte leiden unter derselben ständigen Veränderlichkeit, die alles bestimmt, was im Verlauf der Geschichte passiert. Der erste von ihnen hat einen einzigartigen Namen: Asphragistus. Als wollte man sagen, dass es nicht versiegelt ist, wenn es wahr ist, dass auf Griechisch Sphragis bezeichnet das Siegel. Und tatsächlich leugnet er, der dem Erzähler als Erster die Besatzungsziele der Gruppe verrät, als er später wieder auf der Bildfläche erscheint, er selbst, indem er sich im wahrsten Sinne des Wortes als „Arschloch“ bezeichnet (d. h. „Asphragistus ist ein Idiot“), aber Dann führt ein aufschlussreiches Detail seine verleugnete Identität unwiderruflich auf ihn zurück: Er liebt Sambuca, genau wie Asfragisto (denn er ist Asfragisto). Ein weiteres Mitglied der Sekte, Procopius, ein falscher Latinist, erscheint ebenfalls zunächst in der Rolle eines von Krankheit und Schmerz gekrümmten Bettlers, um später als eleganter Mann mit lässig aufrechter Haltung wieder auf der Bühne zu erscheinen.
Im Allgemeinen finden Begegnungen mit diesen finsteren Gestalten in berüchtigten Bars statt, die von gleichermaßen wandelbaren oder mutierten Barkeepern geführt werden.
Sogar die Klassenkameraden des Erzählers, sogar seine (verstorbene) Mutter und alte Freunde erleiden das gleiche Schicksal, bis zu dem Punkt, dass er nicht davor zurückschreckt, sie für Leichenräuber wie im bekannten Don-Siegel-Film zu halten. Die Dimension des Leichenräubers betrifft, wie sich am Fall der Mutter zeigt, nicht mehr nur die Gegenwart, sondern erstreckt sich auch in die Vergangenheit. Das ist genauso metamorph wie heute und noch mehr als heute. Sogar die Bücher in der Bibliothek des Erzählers verlieren die Kompaktheit ihrer Seiten, die Charaktere vermischen sich, die Geschichten verwirren sich, als würden die Leichenräuber die Erinnerung des Erzählers aussaugen. Der Umzug von Büchern in ein Zweithaus am See oder in eine Nachbarwohnung nützt nicht viel.
Er selbst verdoppelt sich am Ende natürlich und sieht und spürt sein trauriges Getrenntsein, so wie Laura Mars sich selbst in dem ebenso bekannten Film sah.
Nicht alle Charaktere stehen dem Erzähler feindlich gegenüber. Als wertvoller Helfer, der auch über außersinnliche Fähigkeiten verfügt, erweist sich Silenus, der Schneckenmann, der sich von Aceton, Trichlorethylen und dergleichen ernährt. Aber wie wir wissen, ist es sicherlich kein Verfechter der Stabilität, diese formlose Masse, die überall, wo sie vorbeikommt, eine Spur wie Teer hinterlässt.
Aber die stärkste Verteidigung angesichts dieses Angriffs durch solch subtile und aufdringliche oder invasive Feinde scheint die Kultur zu sein. Der Erzähler wird durch eine buchmäßige Verteidigung gestützt, die aus fortlaufenden Zitaten besteht, die von offensichtlichen Foskolismen und Danteismen („Ich bin nicht der, der ich war, ein großer Teil von uns ist umgekommen“, „kleines Gebet“) bis hin zu Machiavellis Brief an Vettori ( „anständig in kurialer Kleidung gekleidet“), von veralteten Latinismen wie „scelo“ oder „rore“ bis zum archaischen Italienisch von Begriffen wie „niego“. Und nicht nur das: Der kontinuierliche Verweis auf Texte, Filme, aktuelle Situationen der Hoch- oder Popkultur scheint dem Bedürfnis zu gehorchen, ein stets aktives Gedächtnis zu zeigen, ein Gehirn, das trotz wiederholter Versuche der Fremdkolonisierung nicht aufhört zu funktionieren. So weit, dass sogar die Geschichte des Kreuzes an der Tür (ein Kreuz, das trotz der Löschungen immer wieder neu gemacht wird) in gewisser Weise philologisiert wird. Dieses Kreuz wird auf den „crux desperationis“ oder Obelus zurückgeführt, ein Zeichen, das die alexandrinischen Philologen neben Passagen setzten, die nicht geändert werden konnten, deren Bedeutung und Buchstabe ungelöst und unlösbar blieben. Das Haus des Erzählers offenbart sich ihm somit endgültig als authentischer „locus desperatus“. Darüber hinaus hatte er bereits vor dieser blendenden Eingebung, über seine nicht wiedererkennbaren Klassenkameraden zu sprechen, das „Adiaphoren-Chaos der Reversibilität“ beschworen, wobei bekannt sein sollte, dass die unentscheidbaren Varianten wiederum in der kritischen Ausgabe jeweils theoretisch genannt werden zulässig, aber nicht ausschließlich. Und dann, wieder, kurz darauf, und wieder für seine Klassenkameraden, die scheinbar zwei parallelen und sich nur teilweise überlappenden Klassen angehörten, wird ein weiterer Fachbegriff der Ekdotik in Frage gestellt, nämlich „contaminatio“. Angesichts des Chaos der Existenz, angesichts des Absurden verlässt sich der Erzähler hartnäckig auf die Rationalität der Philologie. Er philologisiert das Monströse und Groteske. Er wehrt sich.
Sein Leben war immer „ein Leben in der Verteidigung“ (S. 99), ein interstitielles Leben, gelebt „in den Zwischenräumen der Dinge“ (S. 95), ein Leben „delegiert an Dinge und Bücher“, und diese Ausnahmesituation verschärft sich nur noch und steigert diese gewohnheitsmäßige Tendenz zu maximaler Kraft.
Und so werden die Dinge sein, seine disparaten Objekte, seine Sammlungen sowie seine Bücher, alles Elemente, mit denen er nicht nur Zeit verbringt, sondern mit denen er spricht, sich anvertraut und nachdenkt, diese Objekte werden von Psyche durchdrungen sein und nun zu Subjekten werden. als Bollwerk des Hauses zu fungieren und ihrem Lord-Captain-Untergebenen zu dienen, aber ich werde den genauen Weg nicht verraten. Siehe den Leser.
Das Fazit scheint jedoch von Positivität geprägt zu sein.
Man kann das ganze Buch auch als gewaltige Ringkomposition bezeichnen, wie klassische Philologen sagen, eine ringförmige Komposition: Auf der ersten und letzten Seite führt der Erzähler die rituelle Geste schlechthin aus und verschließt die Haustür mit einem Komplex aus elf verschiedenen Operationen: mit dem entscheidenden und sehr bedeutsamen Unterschied, dass am Anfang die Tür tatsächlich geschlossen ist, am Ende nur noch die Schließgeste mimte.
Im Übrigen bemerken wir auch auf diesen Seiten wie auf vielen anderen Seiten desselben Autors Einflüsse von Manganelli (wo der Protagonist als König oder absoluter Monarch seiner häuslichen Umgebung dargestellt wird), von Landolfi (die Begegnung mit dem erweiterten Klassenkameraden, der). sondert Kolostrum ab, sowie die verschiedenen „al secure“, „al tutto“, „alle ugly“, kleinere Landolfismen) und von Gadda, zum Beispiel in der Häufigkeit der Verschmelzung von Substantiven, wie im abnormalen „neo-leek – bubo-spinne von Asfragistus“ oder in der Produktivität des Suffixes -izzato, zum Beispiel in „procopizzato“ und anderen.
Es versteht sich von selbst, dass in diesem dicken, dichten Buch voller Gegenstände das vorherrschende rhetorische Verfahren die Aufzählung ist, und zwar der besondere Fall der Aufzählung, den Leo Spitzer als „chaotisch“ bezeichnete und der hier auf Seite 89 veranschaulicht werden kann : „ein Schnapsglas aus geschliffenem Kristall; ein Weihwasserbecken aus Zinn; ein Asterix-Album (Asterix und die goldene Sichel); eine Fahrradpumpe; ein Billhook; eine Lupe mit Elfenbeingriff; ein leeres Tagebuch aus dem Jahr 1969; ein federunterstützter Tisch-Flipper, ein emaillierter Eisenkrug“.
Insgesamt scheint das gesamte Buch als apotropäisch-talismanisches Objekt bzw. als Zauberspruch konfiguriert zu sein, und zwar sehr gelungen.